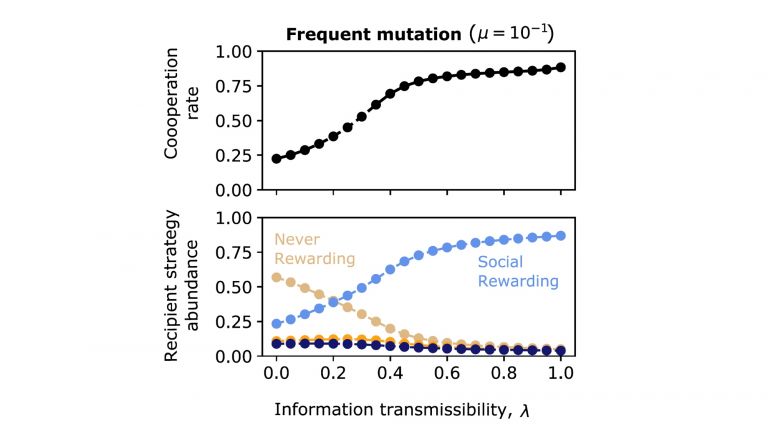Im Takt

Unterm Weihnachtsbaum lassen viele Familien eine alte Tradition wieder aufleben: Gemeinsames Singen und Musizieren. Doch was passiert im Gehirn, wenn wir zusammen musizieren? Und wie gelingt die fein abgestimmte Koordination?
Scientific support: Prof. Dr. Eckart Altenmüller
Published: 30.11.2012
Difficulty: intermediate
- Musik beeinflusst den Gemütszustand von Menschen und schafft ein Gemeinschaftsgefühl: Darin könnte ein Selektionsvorteil liegen, dem der Mensch die Evolution seiner musikalischen Fähigkeiten verdankt.
- Gemeinsames Musizieren ist eine komplexe Koordinationsaufgabe. Das bedarf der auditorischen Vorstellung, Aufmerksamkeitssteuerung und ständigen Anpassung der zeitlichen Abstimmung.
- Für die auditorische Vorstellung grundlegend sind die enge neuronale Verknüpfung zwischen Handlung (Anschlagen einer Taste) und Wahrnehmung (erzeugter Klang) sowie das Spiegelneuronensystem, das im Gehirn des Beobachters oder Zuhörers ähnliche Aktivierungsmuster erzeugt wie beim Ausführenden.
- EEG-Messungen zeigen: Die Synchronisation wirkt sich nicht nur auf die erzeugten Töne aus – sie versetzt auch die Gehirne der beteiligten Musiker in einen gemeinsamen Takt.
Wann und warum sich die Musik im Laufe der Evolution entwickelt hat, ist nicht abschließend geklärt. Die ältesten bekannten Instrumente wurden auf der Schwäbischen Alb gefunden: rund 40.000 Jahre alte Knochenflöten. Experten gehen aber davon aus, dass Musik, etwa in Form von Gesang, sehr viel älter ist. Die anatomischen Voraussetzungen im Bereich von Kehlkopf und Mundhöhle dürften sich mit dem aufrechten Gang vor rund zwei Millionen Jahren entwickelt haben. Ein Faktor für die Entstehung von Musik könnte die sexuelle Selektion gewesen sein. Dieser Theorie zufolge hätten Frauen musikalische Männer bevorzugt. Einem anderen Ansatz zufolge entstand die Musik als Teil einer Ursprache, die noch keine Wörter oder gar Sätze kannte, wohl aber Situationen und Gefühle durch ganz verschiedene Laute ausdrücken konnte – ähnlich wie die „Sprache“ von Babys. Demnach hätte Musik von Anfang an den Sinn gehabt, das soziale Miteinander in der Gruppe sowie vermutlich speziell die Beziehung von Müttern zu ihrem jahrelang unselbstständigen Nachwuchs zu fördern.
„Oh, du fröhliche, oh du seelige…“ Alle Jahre wieder versammeln sich Familien unter dem Weihnachtsbaum. Viele packen sogar eingestaubte Musikinstrumente wieder aus und stimmen gemeinsame Lieder an. Musik zieht uns in ihren Bann – jedenfalls, wenn sie uns stilistisch nicht völlig zuwider ist – und animiert zum Mitmachen. Wohl jeder kennt den Drang, wenigstens zu summen oder sich im Takt zu bewegen, wenn eine gefällige Melodie erklingt. Und wer schon mal in Band oder Orchester musiziert, im Chor gesungen oder wenigstens in einer Menschenmenge ein Lied gegrölt hat, weiß: Gemeinsames Musizieren macht Spaß und tut der Seele gut. Kein Wunder also, dass gerade zur Weihnachtszeit in vielen Familien die gute alte Tradition der Hausmusik wieder auflebt.
Musik ist ein soziales Phänomen. Denn einerseits transportiert sie unmittelbar Stimmungen und Gefühle und schafft sozialen Zusammenhalt – ein möglicher Grund dafür, dass die Evolution diese zwar schöné, aber fürs Überleben scheinbar überflüssige Fähigkeit hervorgebracht hat (siehe Info-Kasten). Andererseits ist sie ein Beispiel für erstaunlich gute Zusammenarbeit und exakte Koordination. Im Schnitt liegen die Musiker guter Ensembles bei ihrem Spiel nur drei bis fünf hundertstel Sekunden auseinander – selbst ohne Dirigent und trotz aller Tempovariationen, von denen gerade klassische Musik lebt.
Wie die feine Abstimmung möglich wird, erforscht der australische Musiker und Psychologe Peter Keller, der eine Nachwuchsgruppe am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions– und Neurowissenschaften leitete, bevor er kürzlich als Dozent nach Australien zurückkehrte. Er fand drei entscheidende Mechanismen. Einen davon bezeichnet er als auditorische Vorstellung und Erwartung: Musikergehirne antizipieren demnach den vom Musiker selbst erzeugten Klang, aber auch die Töné der Kollegen, noch bevor diese tatsächlich im Gehör ankommen und verarbeitet werden.
Wahrnehmung und Handlung eng verknüpft
Diese vorausschauende Vorstellung ist ein komplexer Vorgang. Sie hängt mit der schon zu Beginn der 1990er Jahre formulierten Theorie des „Common Coding“ zusammen. Demnach verarbeitet das Gehirn Wahrnehmung und Handlung nicht getrennt. Vielmehr nutzt es dafür zumindest teilweise dieselben Ressourcen – einen gemeinsamen neuronalen Code. Auftrieb erhielt diese Hypothese 1995 mit der Entdeckung der Spiegelneurone bei Affen, die genau gleich feuern, egal ob das Tier selbst nach einer Nuss greift oder beispielsweise ein Artgenosse.
Auch bei Menschen ist mittlerweile erwiesen: Das Beobachten eines Musikers ebenso wie das Musikhören, ruft – im Rahmen der eigenen Fähigkeiten – eine Resonanz in den entsprechenden motorischen Arealen im Gehirn hervor. So brachten US-Forscher im Jahr 2007 Nichtmusikern bei, ein einfaches Stück zu spielen. Als die Probanden anschließend regungslos im Kernspintomografen lagen und dem Stück lauschten, wurden motorische Areale des Stirn– und Schläfenlappens aktiv, darunter auch das sprachrelevante Broca-Areal. Töne in anderer Reihenfolge reduzierten die Aktivität, bei ganz anderer Musik war nichts zu beobachten (Das musikalische Gehirn).
Ständige Simulation und Prognose
Geübte Musiker haben zudem Erfahrung darin, durch bestimmte Nuancen in der Bewegung, das klangliche Resultat zu beeinflussen. Ihr Gehirn kann aus den selbst erzeugten Bewegungskommandos vorausberechnen, welcher Sinneseindruck – hier: welcher Klang – entsteht und steuert so die Feinjustierung. Das funktioniert mit Einschränkungen sogar für die Aktionen der Ensemble-Kollegen. Das Gehirn versucht unbewusst zu simulieren, was die Mitspieler als nächstes tun werden – „eine Hilfe, das ‚Was, Wann und Wie’ bevorstehender auditorischer Synchronisationsziele vorherzusagen“, wie Keller in einem Buchkapitel über das gemeinsame Musizieren schreibt. Man ahnt, wie schnell, wie laut und mit welchem Ausdruck die anderen eine bestimmte Passage interpretieren, und stellt sich darauf ein.
Aber natürlich kann sich ein Musiker nicht alleine an seinen Erwartungen orientieren. Er muss sich letztlich dem anpassen, was tatsächlich passiert. Deshalb ist Aufmerksamkeitssteuerung laut Keller der zweite bedeutende Mechanismus: Das eigene Spiel und der eigene Gesang bedürfen selektiver Beachtung ebenso wie das, was die Kollegen produzieren, und der Gesamtklang des Ensembles.
Recommended articles
Korrigierbarer Taktgeber im Kopf
Der dritte Mechanismus widmet sich schließlich der zeitlichen Koordination des eigenen Spiels. Damit ein einzelner Musiker den Takt halten kann, muss sein Gehirn regelmäßige, oszillierende Prozesse erzeugen. Bei EEG-Untersuchungen wurden regelmäßige Strukturen im so genannten Gamma-Band zwischen 20 und 60 Hertz identifiziert, die offensichtlich auch für die rhythmische Antizipation wichtig sind. Erzeugt wird der Taktgeber vermutlich von einem weitverzweigten neuronalen Netz, an dem unter anderem motorische und auditorische Cortexbereiche, Basalganglien, Thalamus und Kleinhirn beteiligt sind.
Für das flexible Miteinander im Ensemble passen sich diese neuronalen Oszillatoren der einzelnen Musiker permanent aneinander an. Der Psychologe Bruno Repp, der die musikalische Synchronisation seit vielen Jahren an verschiedenen US-Universitäten erforscht, beschreibt diesen Vorgang als Fehlerkorrekturmechanismus. Bei einer typischen Versuchsanordnung klopfen Probanden mit den Fingern einen Takt, den ein leicht holperndes Metronom vorgibt. Sobald zeitliche Abweichungen im Miteinander zwischen Mensch und Maschine entstehen, steuern die Versuchspersonen gegen. In der Regel passiert das dezent und unbewusst, gesteuert vom Kleinhirn. Grobe Diskrepanzen bedürfen einer nachdrücklicheren Korrektur, in die auch Basalganglien und Präfrontalcortex involviert sind.
Die Synchronisierung klappt umso besser, je genauer ein Musiker den anderen simulieren kann, je ähnlicher sie sich also in ihrem Spiel sind. Das erkannten Repp und Keller im Jahr 2006. Sie ließen Pianisten Stücke für zwei Klaviere spielen – wobei der zweite Part von einem Band kam, das die Versuchspersonen Monate zuvor aufgezeichnet hatten. Dabei zeigte sich: Je mehr sich die Duettpartner während des Spielens in ihren Körperbewegungen ähneln, desto besser gelingt die Anpassung – am besten übrigens, wenn die Pianisten im Duett mit sich selbst spielten. „Das simulierte Timing trifft mit dem tatsächlichen Verhalten dann am besten überein, wenn beide das Produkt desselben kognitiv-motorischen Systems sind“, sagt Keller.
Basalganglien
Basalganglien/Nuclei basales/basal ganglia
Basalganglien sind eine Gruppe subcorticaler Kerne (unterhalb der Großhirnrinde gelegen) im Telencephalon. Zu den Basalganglien zählen der Globus pallidus und das Striatum, und je nach Autor weitere Strukturen, wie z. B. die Substantia nigra und der Nucleus subthalamicus. Die Basalganglien werden primär mit der Willkürmotorik in Verbindung gebracht, beeinflussen aber auch Motivation, Lernen und Emotion.
Gehirnwellen im Gleichtakt
All das lässt erahnen: Musizieren Menschen miteinander, geraten ihre neuronalen Vorgänge in Gleichtakt. Den ersten konkreten Beweis dafür fanden Forscher um Ulman Lindenberger vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin im Jahr 2009. Sie ließen verschiedene Gitarrenduos im Labor eine Jazz-Melodie spielen und zeichneten simultan die EEGs der Musiker auf. In den elektrischen Signalen – besonders im Bereich der Theta-Wellen um 5 Hertz – fanden die Forscher eine signifikante Synchronisierung. Sie betraf unter anderem Hirnareale im Schläfenbereich und im Hinterkopf, die möglicherweise auch in das Genießen von Musik involviert sind.
Genuss und Spaß sind in der Regel die Hauptmotivation dafür, miteinander zu singen oder zu musizieren. Für Stefan Koelsch, ausgebildeter Musiker und Neurowissenschaftler an der FU Berlin, knüpft das Musizieren Kontakte zwischen Menschen. Es ist eine Form der Kommunikation und erfordert die Koordination von Bewegungen und Kooperation für ein gemeinsames Ziel. Und alles zusammen fördert letztlich die soziale Kohäsion, also das Gruppengefühl. „In dieser Hinsicht dient Musik durchaus einem Zweck“, sagt Koelsch. „Sie erfüllt soziale Bedürfnisse, die für das Individuum lebenswichtig sind.“ Derzeit erforscht er, inwieweit sich diese Erkenntnis therapeutisch nutzen lässt.
Fest steht für den Berliner Forscher bereits, dass die soziale Bedeutung des Musizierens mehr ist als eine theoretische Erkenntnis aus dem Forschungslabor. Er verweist auf eine gescheiterte Antarktis-Expedition Ernest Shackletons: Als es um Leben und Tod ging, ließen die Abenteurer alles nicht Überlebensnotwendige zurück und töteten sogar ihre Hunde und Katzen. Nur Zelte und die nötigste Kleidung behielten sie – und ein Musikinstrument. „Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig Musik für den Menschen ist“, sagt Koelsch. „Wie wichtig sie ist, um weiterzuleben, nicht zu verzweifeln, sondern gemeinsam die Sache durchzustehen.“ (Hirnforschung und Musik mit Stefan Koelsch)
zum Weiterlesen:
- Keller, PE. Joint Action in Music Performance In: F. Morganti, A. Carassa, G. Riva (Hrsg.): Enacting Intersubjectivity: A Cognitive and Social Perspective on the Study of Interactions IOS Press, 2008. S. 205 – 221 (zum Text).
- Stefan Koelsch, Brain and Music, Wiley, 2012.